Festrede auf dem Kongress des PEN Berlin am 2. Dezember 2022
Ein Klima digitaler Einschüchterung
Von Ayad Akhtar

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist mir eine große Freude, anlässlich Ihres ersten Kongresses hier in Berlin zu sein. Ich danke Ihnen für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, und ich hoffe, was ich Ihnen heute zu sagen habe, ist Ihnen irgendwie nützlich, wenn Sie sich an die gemeinsame Arbeit machen.
Viele von Ihnen werden wissen, dass der PEN vor 100 Jahren, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, gegründet wurde, unter anderem, damit Schriftsteller miteinander nachdenken und eine gemeinsame Aufgabe in der Welt wahrnehmen, jenseits derer, die sie mit ihren individuellen Werken spielen.
Wenn bereits einzelne Schriftsteller als Knotenpunkte des Gewissens für ihre Gesellschaften wirken – wieviel mächtiger können sie erst sein, wenn sie sich zusammentun, ihre Anstrengungen bündeln und gemeinsam ihren Einfluss geltend machen, um eine gerechtere und ehrlichere Welt zu schaffen.
Über weite Strecken seiner Geschichte konzentrierte sich der PEN America, die Landesgruppe, deren Präsident ich bin, auf den Schutz der Meinungsfreiheit und die Unterstützung verfolgter Schriftsteller außerhalb der Vereinigten Staaten. Im letzten halben Jahrzehnt hat sich der Fokus jedoch zunehmend auf Amerika selbst gerichtet.
Ich will Ihnen heute berichten, was derzeit in den Vereinigten Staaten geschieht – denn das erleben wir oft später auch anderswo. Mit dem Hinweis auf den amerikanischen Einfluss soll nicht gesagt sein, die amerikanische Kultur wäre kreativer oder zeitgemäßer als andere. Die zentrale Stellung Amerikas ist ein komplexes Phänomen, das wahrscheinlich überschätzt wird und im Niedergang begriffen ist. Diesen Niedergang zu konstatieren, bedeutet aber nicht, zu bestreiten, dass Amerika immer noch von zentraler Bedeutung ist.
Krise der Meinungsfreiheit

Ich möchte mit der These beginnen, dass die gegenwärtig in den Vereinigten Staaten zu beobachtende Krise der Demokratie zu einem Gutteil eine Krise der Rede- und Meinungsfreiheit ist.
Natürlich hat es noch nie soviel Rede, soviel frei und ohne jede Hemmungen zum Ausdruck gebrachte Meinung gegeben wie heute. Die Technologie des 21. Jahrhunderts hat die Macht der Medien, der Presse und selbst vieler Regierungen geschwächt und Stimmen gestärkt, die früher gar keine Chance hatten, gehört zu werden. Diese außergewöhnliche neue Freiheit ist meines Erachtens ein zentrales Faktum innerhalb eines großen Paradoxons.
Denn obwohl öffentliche Rede in gewisser Hinsicht eindeutig freier geworden ist, befinden wir uns heute in den USA mitten in einem kulturellen Wandel hin zu einem Diskurs voller strafbewehrter Verbote. Die gegenwärtige Identitätspolitik zwingt uns widersprüchliche moralische Landkarten auf, die bestimmen, welche Rede für welche Gruppe akzeptabel ist und welche nicht. Zunehmend macht sich ein Klima digitaler Einschüchterung breit, und mit ihm die Angst, frei zu sprechen oder auch nur frei zu denken. Im Aufstieg begriffen ist zudem eine tiefe, weitverbreitete Intoleranz gegenüber Ansichten, die für inakzeptabel oder sogar »unmoralisch« gehalten werden.
Noch komplizierter wird dieses beunruhigende Bild durch eine Technologie, die für die Meinungsfreiheit eine zunehmend toxische Umgebung schafft. Die Social-Media-Plattformen haben ihre Geschäftsmodelle verfeinert und gelernt, dass sie mehr Geld verdienen, wenn sie Wut, Unbeständigkeit und Streit fördern. Ihre ausgeklügelten Messverfahren stützen sich auf die Äußerungen, Posts, Fotos, Likes und Kommentare der Nutzer und bilden die Grundlage für eine Programmierung, die das jeweils Ungeheuerlichste und Umstrittenste verstärkt.
Es handelt sich um eine algorithmische, Millisekunde für Millisekunde durchgeführte Kuratierung aller weltweiten Meinungsäußerungen, die Geld – viel Geld – einbringt, indem sie Zwietracht sät, um Aufmerksamkeit zu erregen, und die dabei gewonnenen Daten erntet, um in möglichst jedem Schritt dieses Prozesses Werbeanzeigen zu verkaufen. Dieses Geschäftsmodell hat nicht nur jedes Sprechen im öffentlichen Raum verändert, sondern – vielleicht noch wichtiger – die Bedeutung des Zuhörens.
Verlust der Bedeutung

Dass menschliche Rede kapitalistisch derart ausgebeutet wird, hat eine digitale Apartheid geschaffen, in der sich Gruppen nach Identitätskriterien separieren und nur noch Äußerungen zur Kenntnis nehmen wollen, die ihrer Sicht auf die Dinge entsprechen. Es handelt sich dabei um Meinungen, nicht um Wahrheiten. Schlimmer, um Meinungen, die zur Wahrheit erhoben werden. Und damit wird der Boden bereitet für eine gigantische, hoch emotionale Vermehrung der Desinformation als treibende Kraft der Gesellschaft.
Eines der ersten Opfer unseres so seltsam eingemauerten Zeitalters der Meinungsfreiheit ist die Bedeutung. Denn wenn das Interesse an Wahrheit abnimmt und durch die jeweils bevorzugten Versionen der Realität ersetzt wird, dann schwinden im selben Maße auch Sinn und Bedeutung von Sprache. Wörter und Ausdrücke verweisen nun einmal auf eine bestimmte Identität, auf Zugehörigkeit, auf eine Stellung innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie oder auf Hautfarbe, und diese symbolischen Signifikanten bestimmen in weit stärkerem Maße die Bedeutung dessen, was wir sagen, als es die jeweils verwendeten Worte tun.
Ein Beispiel: Während ich Ende November an meinem Schreibtisch sitze und diese Rede schreibe, wird in Kreisen mir bekannter Lektoren und Literaturagenten viel über ein Buchprojekt diskutiert, das allen größeren Verlagen angeboten worden ist. Es handelt sich um die erste umfassende wissenschaftliche Biographie von Medgar Evers – einer der wichtigsten Gestalten in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre. Der Autor gilt als führender Evers-Fachmann in den Vereinigten Staaten. Doch sein Projekt findet keinen Verlag, weil keiner bereit ist, es anzunehmen. Nicht jetzt, nicht in diesem Klima: denn Medgar Evers war ein Schwarzer, und der Autor des Buchs ist ein Weißer.
Ich erwähne diese Geschichte nicht, weil sie einzigartig wäre – das ist sie nicht. Nicht in der gegenwärtigen Umgebung, in der Wissenschaftler immer wieder entmutigt werden, sich für Themen zu interessieren, die nicht »ihre« sind; in einer Umgebung, in der man jungen Schriftstellern sagt, sie könnten nicht aus fremden Perspektiven schreiben; einer Umgebung, in der sich ein wachsender Widerwille gegen Gefühle oder Ansichten breitmacht, die als verletzend für die eine oder andere Gruppe empfunden werden könnten. Henry Louis Gates Jr, einer der bedeutendsten Denker im heutigen Amerika, beklagte dies in einer Rede, die er 2021 vor dem PEN America hielt. Ich möchte ihn hier zitieren:
»Der Gedanke, man müsse wie das Thema aussehen, um es zu meistern, war ein Vorurteil, gegen das unsere Vorgänger – Frauen, die über Männer schrieben, Schwarze, die über weiße Schriftsteller schreiben wollten – ankämpften. Toni Morrisons Abschluss-Arbeit an der Cornell University war eine Studie über Virginia Woolf und William Faulkner, die 1955 abgeschlossen wurde, im selben Jahr, in dem Rosa Parks sich weigerte, ihren Platz in den nur Weißen vorbehaltenen Teil eines Busses zu räumen. Jedem hinreichend motivierten und engagierten Lehrer, Studenten, Leser, Schriftsteller muss es erlaubt sein, sich frei und ohne jede Einschränkung mit den Themen seiner Wahl zu beschäftigen. Das ist, meine Damen und Herren, nicht nur das Wesen der Bildung – es ist das Wesen des Menschseins.«
Verengung der intellektuellen Neugier

Der in Harvard lehrende Gates kommentiert hier eine Entwicklung, die nicht nur im Verlagswesen stattfindet, sondern im höheren Bildungssystem allgemein. Eine Verengung der intellektuellen Neugier, eine Fokussierung auf »Rasse« und »Identität« als conditio sine qua non für die Legitimation eines Autors; ein intellektueller Tribalismus, der einen »Ausverkauf der menschlichen Phantasie« darstellt. Seine eloquente Verteidigung der Freiheit des Denkens war umso überzeugender, als sie von ihm, einem Afro-Amerikaner, kam – so dachten und sagten es viele nach ihren standing ovations. Viele hofften, dass manche endlich zugehört hätten, weil er ein Schwarzer sei und weil niemand auf ähnliche Reden hören würde, wenn sie von weißen Autoren kämen.
Die unparteiische, vorurteilsfreie intellektuelle und schöpferische Neugier befindet sich im Niedergang – und diese Entwicklung wird von vielen gefördert, die die sogenannte »kulturelle Aneignung« für ein historisches Unrecht halten, das es wiedergutzumachen gelte. Der Gedanke der »Aneignung« erhebt, grob gesagt, gegenüber bestimmten Menschengruppen den Vorwurf, sie hätten ihr Recht auf die Kulturgüter anderer Gruppen verwirkt. Ganz sicher haben Sie schon von dummen, überzogenen Geschichten wie dieser gehört: Studenten im Oberlin College protestierten dagegen, dass in der Cafeteria ihrer Universität Sushi serviert wurden. Doch die Logik der »Aneignung« hat weitaus ernstere Konsequenzen.
Sie behauptet nämlich, mit der Stimme eines anderen Menschen als man selbst zu sprechen sei deshalb problematisch, weil man damit unvermeidlich Gefahr laufe, diese anderen zu verletzen. Mit der Stimme eines anderen als man selbst sprechen – ist aber nicht genau das die Basis jenes magischen Akts empathischer Erweiterung, der die Literatur definiert? Immer häufiger lautet die Antwort auf diese Frage: Nein. Denn wenn Sie über eine Gruppe schreiben, zu der Sie selbst nicht gehören, laufen Sie nach dieser Auffassung automatisch Gefahr, die Mitglieder dieser Gruppe zu verletzen, oder, schlimmer noch, dritte zu ermutigen, sie zu verletzen. In dieser Sichtweise sei zum Beispiel Picassos Darstellung afrikanischer Frauen mitverantwortlich für den europäischen Völkermord an ihnen.
Solche Schäden, die durch Sprache in ihren verschiedenen künstlerischen und nicht-künstlerischen Formen verursacht werden, sind angeblich von größter Bedeutung, zudem wird offenbar angenommen, dass die Gefahren der Aneignung weit größer wären als die Vorteile der Empathie.
Offensichtlich gibt es einige, die das wirklich glauben. Und so dreht sich vieles von dem, was heute als Kulturpflege gilt, in Wirklichkeit darum, kulturelle Aneignung aufzudecken und die damit einhergehende Empörung theoretisch zu stützen.
Eindimensionale Beschreibung »der« Macht

In Amerika haben wir das bei zahlreichen Kunstausstellungen erlebt, von Dana Schutz’ Emmet-Till-Gemälde bis hin zu der immer wieder verschobenen Philip-Guston-Ausstellung. Es begleitet uns von den literarischen Zirkeln und Verlagshäusern, wo man »Sensibilitätslektoren« einstellt, die in den Manuskripten nach potenziell verletzenden Darstellungen suchen sollen, bis nach Hollywood, wo die Netzwerke und Studios verängstigt und die Schreibstuben zunehmend ein Ground Zero für Kämpfe um die Frage sind, wer überhaupt noch Figuren mit anderen Identitäten als der eigenen erschaffen darf und wer schon nicht mehr.
Dabei geht es nicht um ästhetisches und erzählerisches Urteilsvermögen. Es geht auch nicht bloß um die Frage, ob ein Autor das Wissen, den gesunden Menschenverstand sowie die nötige Demut besitzt, um eine Geschichte »gut« zu erzählen – etwas, auf das wir alle hier hoffen, ob wir nun Belletristik oder Sachbuchtexte schreiben. Nein, hier geht es nicht um die Frage, ob der betreffende Autor es gut macht. In Wirklichkeit reicht das Problem sehr viel tiefer. Es hat sich eine verhängnisvolle Auffassung von menschlicher Kreativität herausgebildet. Immer häufiger geht es nicht mehr um die Vorstellungskraft, sondern um Machtverhältnisse.
Diese Perspektive, die von den Sozialwissenschaften entwickelt wurde, begreift Macht als den bestimmenden Maßstab allen menschlichen Wissens. Welche Macht du besitzt, bestimmt, was du weißt und wie du es weißt. Deshalb konnte Edward Saids bahnbrechende Studie über den Orientalismus ein Zeitalter extremen Misstrauens gegenüber dem westlichen Interesse an den Kulturen des Islam und der Levante einläuten. Saids Meisterwerk stand ganz im Einklang mit seiner Zeit und führte eine Art des Denkens über die Bedeutung von Macht in der kulturellen Produktion ein, die die Mächtigen herausforderte und suggerierte, dass die Machtlosen der Wahrheit irgendwie näher seien.
Wenn man dieses Machtverständnis auf die heutigen Maßstäbe von »Rasse« und »Identität« anwendet, ergibt sich daraus reflexhaft ein manichäisches Denken: Weiße als Inhaber der Macht sind suspekt, und der Aufstieg von Nichtweißen in Machtpositionen gilt von vorneherein als gut. Das ist eine teilweise übertriebene Vereinfachung, allerdings eben auch nur teilweise – denn was ich hier beschreibe, gehört zum Klima, das im Kulturbetrieb Amerikas gegenwärtig herrscht.
Aber eine Machtanalyse, die alle Opfer der Geschichte aufwertet, ist nicht nur fehlerhaft, sondern auch ein Spiel, das wirklich jeder spielen kann. Auch Weiße können schließlich Beschwerden formulieren und sich ebenso lautstark wie wir anderen über Kränkungen durch Rede und Sprache beklagen.
Vieles von dem, was diese Sicht der Dinge so problematisch macht, hängt mit der eindimensionalen Beschreibung »der« Macht zusammen. Der Finanzsektor, der Tech-Bereich, die Unternehmensstrukturen, nationale Regierungen und der nichtstaatliche Sektor, die vierte Gewalt, Institutionen der höheren Bildung – sie alle sind zweifellos mächtig. Aber nicht alle sind in gleichem Maße Missetäter. Tatsächlich können wir nur gemeinsam mit diesen Mächtigen Lösungen für unsere größten Probleme finden – für Klimawandel, künstliche Intelligenz, wachsendes politisches Chaos.
Mit anderen Worten, nicht die Hierarchie ist der Feind. Und es geht nicht um Revolution, sondern darum, auf die Mächtigen im Sinne verantwortlichen Handelns einzuwirken; ein Klima zu schaffen, in dem die Meinungsfreiheit Achtung genießt und die Wahrheit zählt. Dazu gleich mehr.
Harte Zeit für die Wahrheit

Einige der hier angesprochenen intellektuellen und kulturellen Dysfunktionen besitzen eine Ähnlichkeit mit Phänomenen, die wir aus der Vergangenheit kennen: sogenannte »Ideologien«, also Doktrinen, die sich als Analysen ausgeben.
Als Schriftstellern ist uns die Vernebelung durch Ideologien vertraut; wir sind dafür sensibel. Tatsächlich nehmen wir solche Vernebelungen häufig aufs Korn. Die Suche nach einer unter ideologischen Schichten vergrabenen Wahrheit macht einen Großteil der besten und wichtigsten Werke der Welt aus. Vor allem diese Verpflichtung, bei der Wahrheit zu bleiben, eint uns doch alle hier und heute, in diesem Raum.
Aber für uns als die Vertreter:innen der Wahrheit liegt ein Teil des Dilemmas darin, dass unser Zeitalter der Meinungsfreiheit zugleich eine so harte Zeit für die Wahrheit ist. Teilweise geht das zurück auf die intellektuelle Dezentralisierung der Wahrheit, die uns die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts beschert hat. Aber das ist nicht der einzige Grund dafür, dass Wahrheit nicht mehr mit der Überzeugungskraft wirkt, die doch ihr bestimmendes Merkmal sein sollte. Heute ist es keine bloße Redensart mehr, wenn man sagt, was dem einen Wahrheit sei, das sei dem anderen Lüge; und was die einen für Desinformation halten, halten die anderen fürs Evangelium.
Der Wettlauf konkurrierender Wahrheiten in unseren Informationsökosystemen definiert zunehmend, was an unserer heutigen Meinungsfreiheit besonders kaputt ist. Dass unsere Gesellschaft derart der digital kuratierten Verbreitung absichtlicher Unwahrheiten verfallen konnte, ja dass diese Unwahrheiten geradezu als ihr Gegenteil durchgehen, ist die erstaunliche Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Es sagt vielleicht etwas über die tiefe Glaubensbereitschaft unserer menschlichen Natur aus, oder über unsere turbulenten Zeiten. Wie dem auch sei, die Aufgabe von Schriftstellern, von Menschen wie uns in diesem Raum, wird nur noch wichtiger in Zeiten eines Verfalls der Wahrheit.
Denn für uns hat Sprache Sinn und Bedeutung. Für uns ist die Sprache nicht das Problem, sondern weist uns den Weg zu den Lösungen. Wir hier in diesem Raum leben mit Worten und durch Worte, und wir glauben, dass Worte das vermitteln können, was wir für mitteilenswert halten und was andere Menschen wissen sollten. Während die Welt von einer digitalen, ans 21. Jahrhundert angepassten Version des Orwell’schen »Neusprech« überschwemmt wird, muss für uns weiter erkennbar bleiben, welche Rolle wir spielen, wenn es um das Vertrauen in die Wahrheit geht.
Fundament der Demokratie
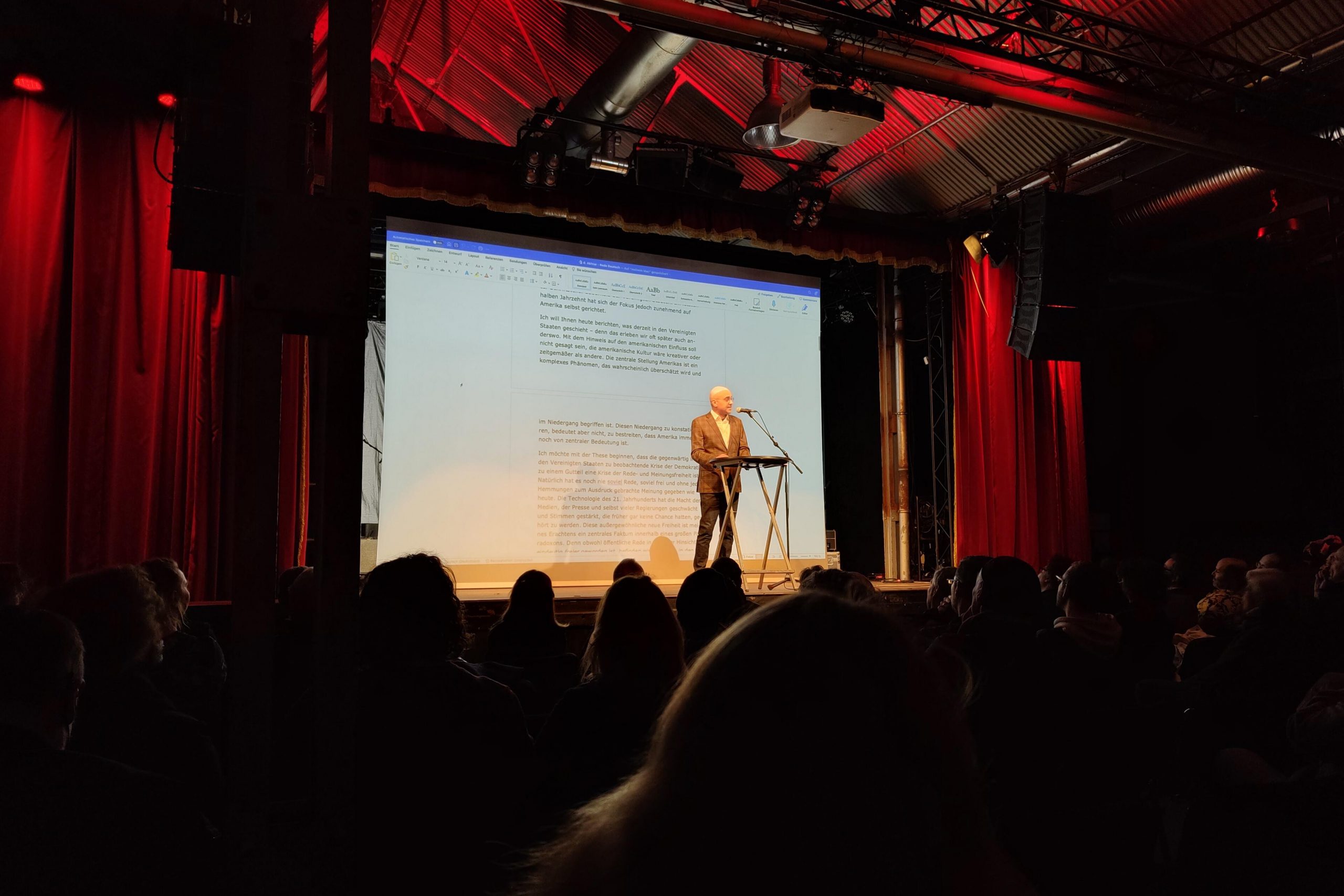
Ich möchte Sie mit einem letzten Gedanken und einem Wort entlassen, das ich heute verwendet habe, dessen Bedeutung, dessen Wahrheit, jedoch gegenwärtig immer dunkler zu werden scheint. Dieses Wort ist »Demokratie«.
Demokratie kann vielen Menschen vieles bedeuten, es ist ein Oberbegriff für eine Existenzweise, die wir in Amerika meist für selbstverständlich halten. Ein Wort mit Konnotationen wie Veränderlichkeit, Reaktionsfähigkeit und Gleichheit, die wir erahnen, aber nicht vollständig erfassen. Grund dafür ist die Tatsache, dass Wahlen zwar das offenkundigste Merkmal der Demokratie darstellen, aber lediglich den Schlusspunkt eines alltäglichen und sich ständig erneuernden Prozesses innerhalb jeder gesunden Demokratie bilden. Dieser Prozess besteht nahezu vollständig aus Rede – aus dem Austausch von Ideen, aus Debatten, Überzeugungen, Kritik und Kommentar. Ein Austauschprozess, der den Kern jeglichen Fortschritts im wissenschaftlichen und menschlichen Wissen, in der politischen Gleichheit, bildet eines Fortschritts, der nur möglich wird durch die Bereitschaft zu forschen, frei zu denken und frei zu sprechen. Selbst dann, wenn die Freiheit, dies zu tun, in Frage gestellt ist – wie es heute der Fall ist.
Die Ausübung der Redefreiheit ist das Fundament der Demokratie. Sie ist buchstäblich das, was Demokratie bedeutet. Bei Rede- und Meinungsfreiheit geht es nicht allein um Sprechen. Wir können nicht immer nur Sprechende sein; wir müssen auch zuhören. Deshalb reicht die Verteidigung der Redefreiheit nicht aus. Wir müssen uns mindestens so sehr für die Anerkennung und Ermutigung des Hörens und Zuhörens einsetzen. Denn ohne Zuhören hat Reden keine Wirkung und besitzt kaum eine Bedeutung, die von Dauer sein kann.
Ich danke Ihnen.
Aus dem Amerikanischen von Michael Bischoff und Eva Menasse.
Ayad Akhtar, 52, ist Schriftsteller, Dramatiker, Präsident von PEN America, dem mit circa 7.500 Mitgliedern größten PEN-Zentrum der Welt. Er wuchs als Kind pakistanischer Einwanderer in Milwaukee auf. Akhtar gehört zu den weltweit meistgespielten zeitgenössischen Dramatikern. 2013 erhielt er den Pulitzer-Preis für Theater, sein Roman »Homeland Elegies« (2020) war ein internationaler Bestseller.
